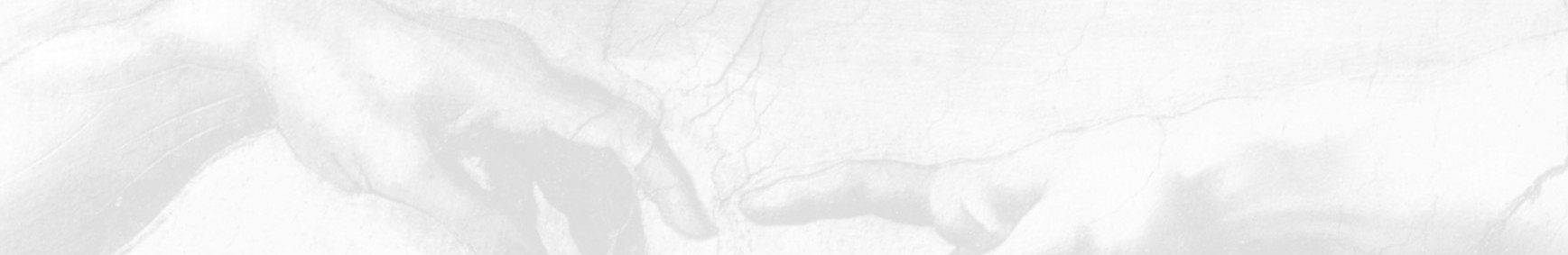Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.
Aus China
Wandel wird zur Norm
Wandel ist eines der meist strapazierten Wörter der Gegenwart. Kaum ein Leitartikel, der nicht irgendeinen Wandel konstatiert, beschwört oder beklagt. Manche Institutionen reagieren auf soviel Wandel gelassen: Entwicklungen kommen und gehen, wir bleiben bestehen. Im Trubel der Innovationskongresse und der betrieblichen Umstrukturierungshektik ist eine solche Haltung wohltuend. Doch kann sich irgendeine Organisation dies auf Dauer leisten, ohne ihre Existenz zu gefährden?
Einige Stichworte können die Dramatik des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels kurz illustrieren.
- Technologische Revolutionen: In der Computertechnik, der Telekommunikation, der Künstlichen Intelligenz, der Chemie, der Robotertechnik, im Transportwesen und – emotional am bewegendsten – in der Gentechnologie jagt eine Neuerung die andere.
- Strukturwandel: Berufliche Arbeit entwickelt sich von der Produktions- zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, das Berufsbild vom lebenslang Angestellten zum lebenslang lernenden Selbstunternehmer.
- Globalisierung: Nationale Schrebergarten-Mentalität ist zu Ende – eine neue Weltordnung bisher nur ein frommer Wunsch. Was immer irgendwo auf der Welt geschieht, hat ziemlich schnell Auswirkungen rund um den Erdball. Das gilt nicht nur für die Corona-Pandemie.
- Wertewandel: Individualisierung wird zum kollektiven Schicksal, Selbstverwirklichung löst die Pflichtenethik ab, bunte Vielfalt bestimmt die Wertelandschaft von der kleinen Beziehungswelt bis zu den großen Deutungssystemen.
Angesichts der hier nur angedeuteten Veränderungsdynamik kann es nicht verwundern, daß zumindest Unternehmen, die auf dem freiem Markt agieren, nicht einfach weitermachen können wie gewohnt. Ohne Anpassung an eine veränderte Umwelt, werden sie schlicht nicht überleben. Inzwischen sind aber auch Organisationen, die, aus welchen Gründen auch immer, vom harten Wettbewerb des Marktes verschont waren, unter Druck geraten: Verbände, das Gesundheitswesen, soziale Organisationen, Kirchen, die öffentliche Verwaltung… Deren Existenz ist sicher nicht gleich gefährdet, wenn sie Veränderungen verweigern. Was zur Debatte steht, ist nicht ihr Fortbestand, wohl aber ihre Wirkungskraft, ihre Präsenz in der Gesellschaft.
„Wenn der Boden unter deinen Füßen plötzlich weg ist…“ – Dynamik des Wandels
Wenn ein Haus umgebaut wird, mag danach alles viel schöner und praktischer sein – für die Bewohner gibt es zunächst einmal ein großes Tohuwabohu. Beim Umbau von Organisationen spricht man mit leichtem Understatement von Irritationen. Gewohnte Abläufe funktionieren nicht mehr, althergebrachte Regeln sind außer Kraft, vertraute Rezepte versagen.
Menschen sind keine Computer, die neue Eingaben nur durchrechnen müssen, bis sie wieder alles auf der Reihe haben. Dramatische Veränderungen lösen Unsicherheiten und Ängste aus. Diese sitzen tief. Rationale Argumente helfen da wenig. Veränderungsprojekte in Organisationen sind deshalb schmerzhafte und strittige Prozesse. Konfrontation und Konflikte sind an der Tagesordnung; Aufregung bis zum Aufruhr ist eine normale Begleiterscheinung; Emotionen und manchmal Eskalation gehören dazu. Durch rechtzeitiges Informieren, durch argumentatives Begründen, durch Beteiligung aller, durch Begleitung von externen Beratern können Veränderungsprozesse bewußt gesteuert werden. Irritationen, Unsicherheit und Ängste werden trotzdem unweigerlich kommen. Das zu wissen und sich darauf einzustellen, ist die erste Voraussetzung für die hohe Kunst, den Wandel zu managen.
Gibt es nicht auch die Faszination des Neuen? Natürlich gibt es die, auch in Organisationen. Nur ist sie schnell vorbei, wenn eine Organisation die erste Veränderungswelle mit entsprechenden Turbulenzen erlebt. In einer abgesicherten Wohlstandsgesellschaft und in ausgebauten Organisationen haben viele etwas zu verlieren und sind deshalb tendenziell eher skeptisch, was Veränderungsprojekte angeht. Es kann ja auch schlimmer kommen…
Viele Veränderungsprozesse in Organisationen kommen dann in Schwierigkeiten, wenn Vertrautes aufgegeben und Ungewohntes eingeführt wird, wenn das traditionelle Gleichgewicht eines Systems in Bewegung kommt und ein neues noch längst nicht in Sicht ist. Das ist die Stunde des Widerstandes, der Besitzstandswahrung, der Machterhaltung. Reformer rufen immer auch Reaktionäre auf den Plan.
Widerstand formiert sich, meistens eher verdeckt und diffus als offen und klar. Kein Grund zur Panik, meinen erfahrene Change Manager. Vielmehr eine Chance, jetzt die angefangenen Veränderungen zu überprüfen, sie falls nötig, noch einmal zu modifizieren und das Neue bewußt einzuüben und zu integrieren. Widerstand in Veränderungsprozessen verhindert die billigen, simplen Lösungen, diktiert von Managementmoden. Insofern hat Widerstand eine kritisch-konstruktive Funktion.
Gelingt es allerdings nicht, den Widerstand in einem dialogischen Lernprozeß aufzuarbeiten, dann bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder der Widerstand wird mit Gewalt gebrochen. Meistens wird dies zu einem Pyrrhussieg, weil eine Organisation dadurch so viele „Verwundungen“ erfährt, daß Motivation und Leistungsbereitschaft für lange Zeit sinken. Oder das Unternehmen begibt sich zurück zum Ausgangspunkt: „früher war ja alles besser“. Das Reformvorhaben ist gescheitert. In Zeiten des allgemeinen Wachstums war das weiter nicht schlimm – in Zeiten allgemeinen Wandels ist es möglicherweise der Anfang vom Ende.
Ein Kompass für unsere Zeit –
Leitbilder und Prinzipien für den Wandel
Wer mitten in einer wilden Brandung schwimmt, verliert leicht die Orientierung. Er braucht Zielvergewisserung. Wenn sich eine Organisation auf das Wagnis des Wandels einläßt, tut sie gut daran, ihre Vision von dem, was sich verändern soll, genau in den Blick zu nehmen. Wer nicht weiß, wohin er will, braucht sich nicht zu wundern, wenn er nirgends ankommt.
Kunden, Qualität und Prozesse
Kundenorientierung meint, den Kunden genau in den Blick zu nehmen, denn er (oder sie) ist die Letztinstanz, die über die Zukunft eines Unternehmens entscheidet. Grundsätzlich war dies den Unternehmern immer klar, in Zeiten eines verschärften, weltweiten Wettbewerbs aber muß es konsequenter und kreativer betrieben werden. Es gilt die Bedürfnisse des Kunden genau zu erfassen, mehr noch als sie dem Kunden selbst bewußt sind. Kunden sind heute wählerisch, ihrer Macht bewußt, von Medien informiert, sie haben spezifische, individuelle Wünsche. Sie wollen nicht nur bestimmte Produkte sondern komplette Lösungen für ihre jeweiligen Fragen und Probleme. Und diese wollen sie als ganzheitliche Dienstleistung angeboten bekommen – zuverlässig, kompetent, freundlich und schnell.
Qualitätsorientierung meint das konsequente und systematische Zufriedenstellen der Kundenwünsche durch ein Unternehmen. Es betrifft Podukt- und Servicequalität, ja sogar die Begegnungsqualität. Diese Qualität muß garantiert und gesichert sein. Das systematische Bemühen um die stetige Verbesserung der Qualität ist der Ausdruck dafür, daß der Kunde ernst genommen wird und die einzige Garantie für den dauerhaften Erfolg eines Unternehmens.
Prozessorientierung meint die Optimierung aller Abläufe im Unternehmen, die notwendig sind, um ein Produkt herzustellen oder eine Dienstleistung zu erbringen. Beschleunigung der Prozesse, Verringerung der Wegezeiten, gelungene Zusammenarbeit an Schnittstellen, gleichbleibende Ansprechpartner für den Kunden sind die Ziele.
Das dialogische Prinzip
In einen Dialog über neue Ideen einzutreten, partnerschaftlich und nicht dogmatisch-besserwisserisch, ist Basis für jeden Veränderungsprozess. Dialog meint nicht einfach häufiges Miteinander-Reden, wie das in vielen Unternehmen und Organisationen mißverstanden wird. Dialog meint „eigene Annahmen aufzuheben“ und sich auf ein „gemeinsames Denken“ einzulassen“ (Peter Senge). Diskussionspartner möchten ihre Sicht durchsetzen – Dialogpartner versuchen, die Sicht der anderen zu verstehen. Konkret: runde Tische einrichten, an denen alle teilnehmen können, jede Idee willkommen ist, Ressourcen und nicht Probleme zählen, der Geist des Brainstorming die Agenda bestimmt und nicht die vorgefertigten Papiere des Vorstandes. Jedes gute Change Management beginnt damit, das Prinzip des Dialogs ernst zu nehmen und miteinander einzuüben. Nur aus einem Dialog kommen Ideen für die Veränderungen und deren Akzeptanz.
Den Wandel aktiv gestalten – drei Dimensionen
Haltungen entwickeln
Keine Organisation wird sich wandeln, wenn ihre Mitglieder und Mitarbeitenden nicht grundsätzlich wandlungsbereit und wandlungsfähig sind. Es geht um die innere Haltung. Je mehr sich das verändert, was einmal von außen Halt gab – Normen, Werte, Gesetze, Sicherheiten, nationale und weltanschauliche Identitäten -, desto mehr zählt die innere Haltung. Haltungen kann man nicht verordnen; sie können nur wachsen. Selbständiges Arbeiten und Handeln, mutiges Entscheiden in unterschiedlichen Situationen – und das Einstehen für das eigene Tun, das Bedenken von Folgen und die Übernahme von Ver-ant-wortung. Unternehmen, die sich auf einem harten Markt behaupten müssen, brauchen Mitarbeiterinnen, die an der „Kundenfront“ nicht wie abhängige Angestellte handeln, sondern wie selbständige Unternehmer. Die Frage ist nur, ob die Unternehmensleitung tatsächlich selbstverantwortliche Mitarbeiter will. Bequem sind diese natürlich nicht. Mündige und mutige Mitarbeitende sind aber wichtigste Ressource von Organisationen, die wendig und wandlungsfähig sein wollen.
Strukturen entwickeln
Manche Organisationen besitzen schon aufgrund ihrer Größe die Unbeweglichkeit eines Tankers. Was die politische Kraft in der Gesellschaft angeht, mag dies Vorteile bringen, für ein Management des Wandels ist es ein gravierender Nachteil. Vieles spricht dafür, daß große Organisationen gegenwärtig nur dann erfolgreich sind, wenn sie dezentrale Strukturen stärken. Es geht um konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips; um dezentrale Ressourcenverantwortung. Dies verlangt Kommunikationsstrukturen, die nicht nur von oben nach unten, sondern auch umgekehrt funktionieren. „Wachstum einer Organisation heißt, daß die Reichweite, Vielfalt und Leistungsfähigkeit ihrer Kanäle zur Aufnahme von Informationen aus der Außenwelt vergrößert wird…“ (Karl W. Deutsch).
Die Organisationskultur entwickeln
Menschen handeln innerhalb eines Systems ziemlich logisch. Verweigern sie sich dem Wandel, beharren auf Besitzständen und zeigen sich flexibel wie eine Betonwand, ist das oft die persönliche Umsetzung der gewachsenen Unternehmenskultur. Es gehört zum „Geist des Hauses“ sich so zu verhalten. Viel hängt deshalb davon ab, ob die Kultur einer Organisation Raum bietet für Dialog, Kreativität, Experimente, Risiko und Lernen. Geprägt wird die Kultur nicht zuletzt durch das Verhalten der Führungskräfte. Durch häufiges öffentliches Auftreten geschult, sind diese oft verbale Meister des Dialogs, in der Praxis manchmal dialogische Dilettanten. Reden schaffen keinen Dialog, viele Reden sind die systematische Verhinderung des Dialogs. Dialog ist Antworten und Fragen, Reden und Zuhören, Lehren und Lernen, Geben und Nehmen – kurz: eine Zwei-Wege-Kommunikation. Was eine Organisation tut, ist nicht das primäre Thema des Change Managements – viel eher wie sie es tut.
Nur im Zusammenspiel von Haltungen, Strukturen und Organisationskultur gelingt ein organisatorischer Wandel, der die Zeichen der Zeit ernst nimmt und die eigenen strategischen Ziele konsequent im Blick behält.
Management des Wandels konkret
„Scouts“ – die Rolle von kleinen Gruppen
Der Weg in ein neues Land ist die Stunde der Kundschafter. Unternehmen, die neue Herausforderungen angehen, haben dafür eigene Instrumentarien entwickelt. Sie setzen zum Beispiel auf die kreative Kraft kleiner, interdisziplinärer Arbeitsgruppen, die sich in relativ kurzer Zeit kundig machen und mit neuen, durchdachten Ideen und Vorschlägen zurückkommen. Was immer die Namen dafür sind – Projektgruppen, Verbesserungsgruppen, Qualitätszirkel – es geht darum, in begrenzter Zeit, im Zusammenspiel vorhandener Erfahrungen, konkrete Modelle mit Varianten zu entwickeln. Liegen diese auf dem Tisch, braucht es Entsheidungen und konsequente Umsetzung.
„Workshops“ – Beteiligung ermöglichen
Ein Monopolist oder ein subventioniertes Unternehmen kann es sich leisten, dass nur ein paar an der Spitze denken und lenken – ein Unternehmen im Wettbewerb nicht. Sie können es auch poetischer ausdrücken: Es gilt das Gold in den Köpfen der Mitarbeiter zu heben, das sich angesammelt hat aus langer Erfahrung, vielen Experimenten, Fehlern, Kundenkontakten und persönlichen Neigungen. Mitarbeiter beteiligen heißt Erfahrungen aktiv abfragen und auf Ideen aufmerksam hören. Wenn man dies nicht zwischen Tür und Angel macht, sondern Zeit und Raum dafür bereit stellt, entsteht ein Workshop. Dies ist ein etwas vager Sammelbegriff für unterschiedliche Formen, systematisch und moderiert Mitarbeiter zu beteiligen – egal ob es 5 oder 500 sind.
„Talentschuppen“ – Personal entwickeln
Veränderungen gestalten Menschen nicht Maschinen. Mitarbeiter deren Talente durch eine systematische Personalentwicklung gefördert und gefordert werden, trauen sich das auch. Es ist wie bei einem Fußballspiel: Vor dem Anpfiff braucht es Training und taktische Abstimmung – im Spiel selbständiges Agieren jedes Spielers und Achten auf die anderen im Team – danach gemeinsames Reflektieren und Lernen. Dazu gehört, dass sich ein Vorgesetzteer als Coach versteht und nicht als Oberexperte, dass alle Formen interner und externer Fortbildung gezielt eingesetzt werden. Nicht hier ein Kurs und dort eine Tagung aus irgendeinem dickleibigen Weiterbildungskatalog, sondern Auseinandersetzung mit dem einzelnen Mitarbeiter, mit seinen Herausforderungen, mit seinen Stärken und Schwächen. Ein Entwicklungsprogramm vereinbaren, individuell und spezifisch.
„Teams“ – Kooperation praktizieren
Hinter der Hinwendung zur Teamarbeit im modernen Management steht die anthropologisch tief verwurzelte Bedeutung kleiner Gruppen für die Gestaltung des menschlichen Lebens. Menschen wollen soziale Kontakte und können ihre Potenziale am besten in überschaubaren, mit unterschiedlichen Talenten besetzten Gruppen entfalten. Allerdings, das Zusammenkommen mehrere Personen zu einer Sitzung oder in einer Abteilung ist noch längst nicht Teamarbeit. Es geht um gemeinsame Ergebnisverantwortung. Wird einem Team Verantwortung übertragen, dann entwickelt es mit erstaunlicher Leistungskraft und Kreativität Ideen und setzt diese um. So wird ein Team auch ganz selbstverständlich zu einem „Lernort“ im Unternehmen.
„Schlankheitskur“ – Hierarchien abbauen
Fast alle Unternehmen begannen in der Garage. Veränderungsmanagement ist kein Problem. Zum Problem wird dies erst in den ausgebauten Konzernzentralen aus Glas und Beton. Machterhaltungstendenz der Mächtigen ist der größte Feind notwendiger Veränderungen. Die ausgebauten hierarchischen Systeme, die Macht sehr weit oben zentralisieren, weichen heute zugunsten der Ermächtigung der Mitarbeitenden an der Basis. Eine „Schlankheitskur“ für Organisationen darf sich nicht im Sparen durch Stellenstreichungen erschöpfen, sondern muss die hierarchische Pyramide umdrehen: Oben sollten die „Kunden“, die Adressaten stehen, dann kommen die Mitarbeiter, die mit ihnen und für sie schaffen und dann erst kommen die Führungskräfte. Deren Aufgabe ist es, hilfreiche Dienstleistungen für die Mitarbeiter zu erbringen. Was hilfreich ist, muß auch aus der Perspektive der operativ Handelnden, nicht nur der Organisationszentrale entschieden werden.
Gute Organisationen graben ihre Ressourcen aus
Change Management ist kein technokratisches Instrument, um Effektivität zu verbessern oder Mitarbeiter von den Vorhaben der Chefs zu überzeugen. Change Management ermutigt die Chefs eher zur Kunst des „Loslassens“. Es geht darum, den Mitarbeitenden Freiräume zu eröffnen, um aus ihrer Sicht notwendige Veränderungen durchzuführen, so dass sie selbst dafür Verantwortung übernehmen können. Das ist eine Grundhaltung, ein Ethos; als bloße Technik ist es unwirksam. Letztlich geht es um Vertrauen und Zutrauen in andere Menschen – nicht auf Macht, sondern auf Ressourcen setzen. Daraus wächst Zukunftsfähigkeit.
Meinrad Bumiller