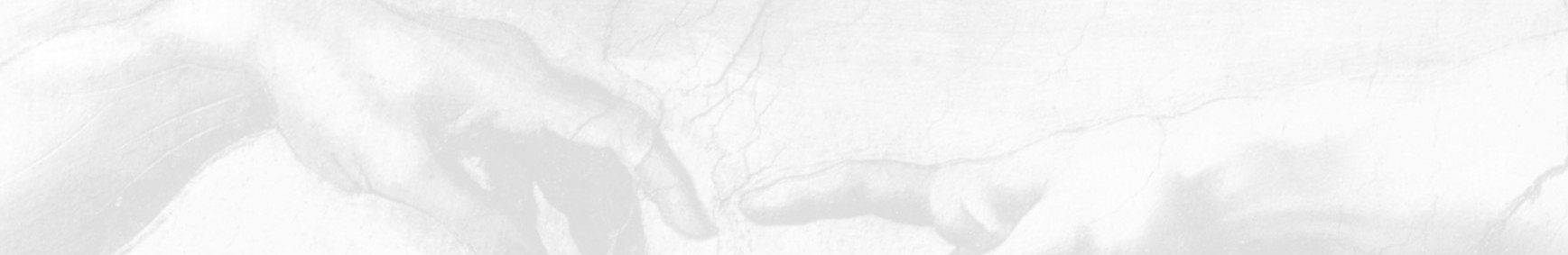Ob ein System überlebensfähig ist oder nicht, liegt vor allem an der Art der Kommunikation zwischen seinen Teilen, anders gesagt, an der kybernetischen Rücksteuerung, die das Funktionieren des gesamten irdischen Lebens seit seinen Anfängen garantiert hat.
Frederic Vester
Die real existierende Kommunikation ist in Organisationen, so die leidvolle Erfahrung vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine Quelle von Missverständnissen, Verzögerungen, Unzufriedenheiten und von Konflikten. Dabei haben wir doch alle das Miteinander-Reden von Kindesbeinen an gelernt. Die meisten Menschen neigen deshalb auch zur Ansicht, Kommunikation in Organisationen müsste eigentlich gelingen, wenn die Beteiligten nur wollen und man eine gemeinsame Sprache hat. Die Praxis lehrt anderes. Da sagt einer etwas, der andere hört etwas ganz anderes, beide gehen auseinander im Glauben, der Sachverhalt sei klar und auch was jeder zu tun habe. Später, meistens zu spät, stellt sich heraus, dass sich beide nicht verstanden und gegeneinander statt miteinander gearbeitet haben. Dann beginnt die leidige Schuldsuche, die in Vorwürfe mündet und zu Verletzungen führt. Dabei hat jeder und jede nur das umgesetzt, was er oder sie gedacht hat. Nicht gelungen ist die Rückkoppelung über die verschiedenen Bilder im Kopf.
Wie geht dann „richtige“ Kommunikation? Viele Seminare und Bücher behaupten, darauf die Antwort zu haben. Hinter diesem vollmundigen Versprechen steckt ein mechanistisches Menschenbild. Der Mensch wird als eine Art Computer betrachtet, die Mitarbeiter in einer Organisation brauchen jetzt nur noch alle die gleiche „Software“, sie werden richtig „programmiert“ und dann muss die Kommunikation klappen. Doch Menschen sind keine Maschinen, menschliches Gehirn funktioniert anders als Computer; wir haben nicht alle das gleiche „Programm“, sondern eine höchst individuelle „Kommunikationssoftware“, wir transportieren unsere Bilder im Kopf zu anderen Menschen in einer sehr eigenwilligen Sprache und Körpersprache. Jeder spricht, „wie ihm der Schnabel gewachsen ist“.
Nicht kommunikative „Gleichschaltung“ sondern Begegnung von Vielfalt
Eine Organisation ist ein Ort lebendiger und vielfältiger Kommunikation: Vier-Augen-Gespräche, Besprechungen, Versammlungen, Mitarbeitergespräche, Gespräche auf Gängen, am Kaffeeautomat. Vorgesetzte, Mitarbeitende, Kunden kommen aus unterschiedlichen Milieus, von verschiedenen Bildungen und Erfahrungen geprägt. Deshalb lösen einzelne Begriffe unterschiedlichste Bilder in den verschiedenen Köpfen aus, bestimmte Sätze werden emotional völlig verschieden bewertet und mit entsprechenden Stimmungen aufgeladen. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass es in einer Organisation zugeht, wie beim Turmbau zu Babel. Und dies nicht, weil inzwischen in vielen Organisationen Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen zusammentreffen.
Organisationen sollten deshalb nicht nach der „richtigen“ Kommunikation suchen, sondern nach einer Kultur der Kommunikation. Eine Kultur kann nicht gemacht, nur gepflegt werden. Sie wird die Vielfalt nicht beschneiden, sondern entfalten. Nicht „Gleichschaltung“ ist angesagt sondern Begegnung, Dialog von Verschiedenen. Nicht um „richtiges“sondern um sorgfältiges Reden geht es.
Fünf Eckpunkte für Kommunikationsentwicklung in Organisationen
Aufmerksamkeit für Kommunikation in einer Organisation beginnt mit der Gestaltung fünf wichtiger Eckpunkte. Diese gehören ins Zentrum jeder Organisations-Kultur.
Regelmäßig und bewusst kommunizieren
Kommunikation braucht Zeit oder besser feste Zeiten. Es wird nicht zu wenig geredet – es wird zu wenig bewusst und sorgfältig miteinander geredet. Gespräche finden oft zwischen „Tür und Angel“ statt. Da sagt eine Chefin ihrem Mitarbeiter im „Vorbeilaufen“, dass er beim letzten Projekt hervorragende Arbeit geleistet hat und merkt nicht, dass die gedachte „motivierende Wirkung“ dieser Anerkennung in der allgemeinen Hektik auf dem Gang schlicht verpufft.
Wenn Kommunikation entscheidend für das Gelingen von Führung, Kooperation, Lernen und Innovation ist, dann braucht gerade sie Qualitätssicherung. Ein Moment dafür ist die Regelmäßigkeit. Besser wöchentlich eine knappe Stunde Austausch der Beteiligten im Projektteam, statt „nach Bedarf“ drei Stunden. Regelmäßige Mitarbeitergespräche zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten einmal im Jahr sind nicht ersetzbar durch anlassbezogene Kommunikation hier und da, oft gestört, meistens oberflächlich. Gespräche werden nicht dadurch besser, dass man sie möglichst in die Länge zieht. Ein Gespräch bekommt für alle Beteiligten eine Bedeutung, wenn es bewusst geführt wird, wenn die Gesprächspartner ihre Zeit jetzt für das Gespräch reservieren, eine „Auszeit“ von all den anderen Dingen nehmen, die heute auch noch erledigt werden müssen.
In vielen Befragungen und Diagnoseworkshops wird deutlich, dass Mitarbeiter nach ihrer Einschätzung zu wenig mit ihrem Vorgesetzten sprechen können. Fragt man den Chef, reagiert der empört: „Ständig spreche ich mit denen, täglich, der größte Teil meiner Arbeitszeit besteht aus Gesprächen mit Mitarbeitern…“ Wer lügt?, Weder der Vorgesetzte noch die Mitarbeiter. Nur die Wahrnehmung ist völlig verschieden. Mitarbeiter achten auf die Qualität der Kommunikation, Vorgesetzte auf die Quantität der Gespräche. Viele haben die klassische Szene erlebt: Ein Vorgesetzter spricht mit einem Mitarbeiter und unterschreibt nebenher irgendwelche Schriftstücke. Dieses Gespräch kann stundenlang dauern, die Wirkung ist gering, weil die Begegnung fehlt. Ob Begegnung gelingt, wird vor allem an der Körpersprache sichtbar: Auf jemand zu-gehen, sich ihm zu-wenden, ihn an-sehen, in Kontakt kommen (lat.: contactus = Berührung). In einem aufmerksam geführten Gespräch – sei es noch so kurz – reserviere ich meine Zeit für einen anderen. Weil Zeit das kostbarste ist, das Menschen haben, bringt gerade dies Wertschätzung zum Ausdruck. Eine Organisation praktiziert Kommunikationskultur, wenn sie Zeiten für die verschiedenen Gesprächsanliegen festlegt, wenn diese transparent sind, wenn die Gesprächspartner pünktlich sind und konzentriert, wenn der Fokus auf dem Gespräch liegt und nicht noch nebenher anderes am Smartphone erledigt wird.
Räume für den Dialog
Kommunikation braucht Orte. Zugegeben, es klingt banal. Aber viele Organisationen haben hier Defizite. Zwar sind Betriebsräume meist funktionsgerecht, Eingangsbereiche manchmal sogar schön. Was fehlt sind kleine Gesprächszimmer, ruhige Ecken für das informelle Gespräch, kommunikationsorientierte Konferenzräume. Bei vielen Besprechungs-Räumen merkt man schnell, dass der Raumplaner wohl eher an Vorträge dachte als an Dialog, mehr an Vorgesetztenanweisungen als an gemeinsames Ringen um adäquate Problemlösungen.
Alle Kulturen haben Plätze geschaffen, die zum Gespräch einladen. Dies zeigt ein Blick in alte Städte und gewachsene Dörfer. Die moderne Architektur hat diesen Aspekt zu lange vernachlässigt. Bauliche Veränderungen sind meist schwierig und kostspielig. Aber Tische und Stühle auswählen und anordnen, mit Bildern und Blumen Atmosphäre schaffen, mit Visualisierungsmöglichkeiten darauf zielen, dass alle etwas Gemeinsames erarbeiten und nicht jeder für sich mitschreibt oder gar in seinen Akten liest – dies alles verbessert Kommunikation und damit Effektivität und ist nicht sehr aufwändig.
Adäquate Medien
Kommunikation braucht Mittel. Heute gibt es davon vieles: Pinwände, Flip-Charts, Moderationsausrüstung, PC, Beamer – die gesamte neue Kommunikationstechnologie. Menschen haben unterschiedliche Weisen der Verankerung von Wissen, methodische Vielfalt ist hilfreich. Vor allzu großem technischen Aufwand ist eher zu warnen. Elektronische Kommunikationsmedien sind hilfreich für Präsentationen, im Dialog bauen sie Barrieren zwischen Beteiligten auf, verhindern eher Begegnung. Wirkliche Begegnung von Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven, Ansichten, Interessen, Erfahrungen ist aber die entscheidende Quelle für ein gemeinsames Vorankommen in der Sache, für eine Entwicklung.
Moderation aktiviert zur Beteiligung
Viel ist schon gewonnen, wenn sich Organisationen darüber klar werden, dass ein Gespräch in einer Gruppe (selbst wenn diese sehr klein ist) zielorientierter und effektiver wird, sobald jemand die Moderatorenrolle übernimmt. Dass sich alle immer gut vorbereiten, immer aktiv und konstruktiv einbringen, ist angesichts beruflicher Belastungen eine Illusion. Moderation entlastet alle Beteiligten. Einer oder eine bereitet das Treffen vor, kümmert sich um Zeit und Ort, sorgt für Visualisierungsmöglichkeiten, bietet eine Struktur und einen Zeitplan, denkt an Dokumentation und Information. Wenn er oder sie dies auch noch kompetent macht, methodisch angemessen, anregend für die Teilnehmer – dann um so besser. Unterschiedliches Vorgehen von Moderatoren ist dabei kein Problem, eher eine Chance für Lebendigkeit. Deshalb ist es auch sinnvoll, wenn nicht immer nur der Chef moderiert oder irgendein ausgeguckter Profi, sondern rollierend alle. Wer weiß, dass er diese Rolle auch mal übernehmen muss, bringt sich aktiver und konstruktiver ein.
Ziel von Gesprächsmoderation ist die Aktivierung aller Beteiligten, um bestmögliche Ergebnisse bei den Themen zu erzielen. Ressourcenorientierung heißt das im Jargon. Besprechungen sind ziemlich teuer, denn es handelt sich um Arbeitszeit vieler Personen. Das kann aber nicht primär heißen, möglichst schnell zum Ende zu kommen und allem zuzustimmen, was irgendjemand vorgedacht hat. Ein teures Treffen muss sich dadurch rechtfertigen, dass die Kreativität aller, die jetzt da sind, auch ins Spiel kommt und gute Ergebnisse zeitigt: Moderieren als Animieren.
Vereinbarte Regeln schärfen den Blick für Kommunikation
Kommunikation braucht Regeln. Viele Kommunikationsfachleute haben versucht, prägnante Gesprächsregeln zu formulieren. Im politischen Bereich werden sie in Form von Geschäftsordnungen formalisiert. Wenn sich Organisationen neben ihrer sonstigen Arbeit als Kommunikationssorte verstehen, macht es Sinn, dafür gemeinsam Regeln zu entwickeln. Manche fürchten, dass dabei nicht mehr herauskommt als allgemein übliche Höflichkeitsregeln, nach dem Motto: „Wir lassen andere ausreden…“ Bei Gesprächsregeln kommt es aber gar nicht auf Originalität an. Im Vordergrund sollte der Vereinbarungsprozess stehen. Wenn das Regelwerk in den Augen mancher nicht mehr ist als eine Sammlung von Selbstverständlichkeiten, macht das gar nichts. Zum einen gibt es in einer pluralistischen Gesellschaft mit einem hohen Individualisierungsschub eben immer weniger Selbstverständlichkeiten. Zum anderen ist das Vereinbaren von Regeln eine Möglichkeit, eine Corporate Culture zu entwickeln. Vereinbarte Regeln unterstützen Moderatoren und Führungskräfte, geben für alle Beteiligten eine anspruchsvolle Meßlatte, schaffen Transparenz für die interessierte Öffentlichkeit und bieten eine Lernstruktur – nicht nur für Mitarbeitende auch für Vorgesetzte – Unternehmen als lernende Organisationen.
Dreidimensionale Umsetzung: Fähigkeiten, Strukturen, Kultur
Die fünf Eckpunkte sind keine revolutionäre Erkenntnis. Das Problem ist, dass diese „Selbstverständlichkeiten“ in allen Organisationen in der Praxis zu wenig gelebt werden. Dies führt zu Problemen, die dann an anderer Stelle virulent werden: schlechtes Image, zu langsame Abläufe, mangelnde Mitarbeitermotivation, schwelende und offene Konflikte. Wer auf eine Organisation als qualifizierten Kommunikationsort zielt, braucht eine Umsetzung entlang von drei Dimensionen.
Kommunikative Fähigkeiten der Mitarbeiter entwickeln –
Kommunizieren lernt man ein Leben lang
Weil alle Mitarbeiter Kommunikatoren sind, brauchen sie kontinuierlich Kommunikationstrainings. Es geht dabei nicht darum, Kommunikationsfachleute auszubilden. Vielmehr sollte das Anliegen einer dialogischen Kommunikation im Blick auf eine spezifische Organisation und auf bestimmte Gesprächssituationen – Kunden- oder Mitarbeitergespräche, Konfliktgespräche, Fördergespräche etc. – gemeinsam praktisch weiterentwickelt werden. Dazu braucht es Angebote mit Workshopcharakter, Impulse von außen und Adaption an die jeweilige Unternehmenssituation. Gerade weil es nicht die richtige Kommunikation gibt, braucht es die ständige Weiterbildung – weniger um Neues zu lernen, mehr um die eigene Praxis zu hinterfragen und zu reflektieren. Bei Gesprächen kommt es auf Nuancen an: beim Formulieren und in der Körpersprache, beim Umgang mit eigenen und fremden Emotionen, beim Bearbeiten von Konflikten. Hier sind wir alle ein Leben lang Lernende; wenn dies gerade die Führenden ernst nehmen, hat dies auch eine stilbildende Wirkung im Blick auf die Unternehmenskultur.
Ein Gesprächsfeld hat wachsende Bedeutung bekommen: „Kommunikation mit der Öffentlichkeit“. Es geht um die Verantwortung einer Organisation in der Gesellschaft. Pressegespräche, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit öffentlichen Institutionen, Darstellung des eigenen Profils, Rechenschaft über die geleistete Arbeit, Menschen gewinnen für Veränderungen – das sind für Organisationen entscheidende Themen mit einem hohen kommunikativen Anteil. Zumindestens zum Teil erfordern sie auch andere kommunikativen Fähigkeiten als die interne Kommunikation.
Kommunikation strukturell verankern –
Organisationsentwicklung braucht vielfältige Meetings im Dialogstil
Gute Organisationsstrukturen zeichnen sich dadurch aus, dass sie viele und vielfältige Kommunikationskanäle haben und diese vor „Verstopfung“, „Verkalkung“ und „Austrocknung“ bewahren. Jeder Praktiker weiß, dass dies nicht mit einem schönen Organigramm oder der modischen Beschwörung der neuen Kommunikationstechnologie getan ist. Vielleicht passt hier das Wort von den „Mühen der Ebene“.
In den letzten zehn Jahren haben eine große Zahl von Unternehmen, Organisationen und Behörden das sogenannte „regelmäßige Mitarbeitergespräch“ eingeführt. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Erfahrung, dass ein regelmäßiges Gespräch für die Partner eine heilsame Wirkung hat – ganz egal, wie es im Einzelfall verläuft. Kommunikation braucht offensichtlich das Moment einer „Institution“. Für Personalentwicklung und Führung hat dies eine große Bedeutung: Coaching, Förderung, Potenzialentwicklung und vieles andere bleiben ohne verbindliche Gespräche dafür meist nur „Papiere“. Kommunikation braucht Nachhaltigkeit! Regelmäßige Vier-Augen-Gespräche kosten viel Zeit – diese hat aber auch eine hohe Wirkung im Blick auf Mitarbeiterführung.
Eine Organisation, die Entwicklung auf ihre Fahnen schreibt, hat vielfältige Besprechungen. Wenn diese als Dialogorte qualifiziert werden, spart das Kosten (Stichwort Effizienz), erreicht Zufriedenheit der Beteiligten (Stichwort Motivation), verbessert Kooperation (Stichwort Synergieeffekte) – bereits drei Gründe, der Gestaltung von Besprechungen Aufmerksamkeit zu widmen. Dialog ist dabei zu verstehen als gezielter Austausch verschiedener Sichtweisen, um gemeinsam zu lernen. Diskussionspartner möchten ihre Sicht durchsetzen – Dialogpartner versuchen, die Sicht der anderen zu verstehen. Entwicklung dialogischer Besprechungen ist Führungsaufgabe. Führende sollte dazu animieren, die Kommunikation in den Sitzungen offen zu reflektieren, statt selbst wie ein aufgescheuchtes Reh von Meeting zu Meeting zu hetzen. Für Besprechungen gibt es inzwischen viele erprobte Werkzeuge: Workshops, Visualisierungshilfen, Moderationsmethoden, Arbeitsmittel, Großgruppenanimation. Handwerkszeug, das den Organisationen nicht fremd ist – aber oft wenig professionell eingesetzt wird.
Eine Kultur der Kommunikation entwickeln – Die „aktive“ Organisation
Inspirierender Ort für eine Kommunikationskultur in Organisationen ist die Agora, jenes steinerne Rund, in dem die Bürger Athens sich zur Volksversammlung trafen. Dort geschah ein „Neubeginn der Weltgeschichte“ (Christian Meier). Das Bild von miteinander diskutierenden und streitenden Bürgern auf einem offenen Platz der Polis wurde ein Leitbild für Europa. Hannah Arendt hat diese Kultur prägnant beschrieben: „Eine Sache kann sich unter vielen Aspekten nur zeigen, wenn Viele da sind, denen sie aus einer jeweils verschiedenen Perspektive erscheint. Wo diese gleichberechtigten Anderen und ihre partikularen Meinungen abgeschafft sind, wie etwa in der Tyrannis, … ist niemand frei und niemand der Einsicht fähig, auch der Tyrann nicht“. Es geht nicht um Demokratisierung im Sinne von Mehrheitsentscheidungen, sondern um Vielfalt der Perspektiven als notwendige Voraussetzung für das Entscheiden. Die Agora kann heute auch eine digitale Plattform sein.
Je komplexer und weitreichender die zu lösenden Probleme sind, desto mehr Kommunikation brauchen wir, desto höher ist der Vermittlungs- und Verständigungsbedarf. Organisationen sollten die Lebendigkeit der athenischen Agora entfalten: wirkliche Begegnung verschiedener Menschen, offener Austausch unterschiedlicher Perspektiven und Meinungen, Interdisziplinarität, gemeinsames Ringen um Zukunftsgestaltung, zielorientiertes Lösen von Problemen durch einen Wettbewerb der Ideen.
Die Formen, dies in unterschiedlichen Organisationen umzusetzen, sind vielfältig. Der entscheidende Prüfstein heißt meines Erachtens: Können sich alle in einem offenen Dialog einbringen und dabei erleben, dass ihr Beitrag gehört und ernst genommen wird? Dies ist entscheidend für die Praxis der Organisationsentwicklung, für die Akzeptanz einer Organisation durch Kunden und Mitarbeitende, damit auch für ihren wirtschaftlichen Erfolg. Unter anderem wird es heißen: Dem Zuhören mindestens so viel Aufmerksamkeit zu widmen wie dem Sprechen, übliche Bilder in den Köpfen in Frage zu stellen, gemeinsam das Unternehmen als Ort des Dialogs zu gestalten. Organisation als Kommunikationsgeschehen ersetzt nicht Qualität bei Produkten und Dienstleistungen. Das ist ein Missverständnis des Medienzeitalters. Dialog in Organisationen – geübt, strukturiert und kultiviert – kann allerdings die Produkte und Dienstleistungen verbessern, weiterentwickeln und ihren Nutzen für die Kunden darstellen.