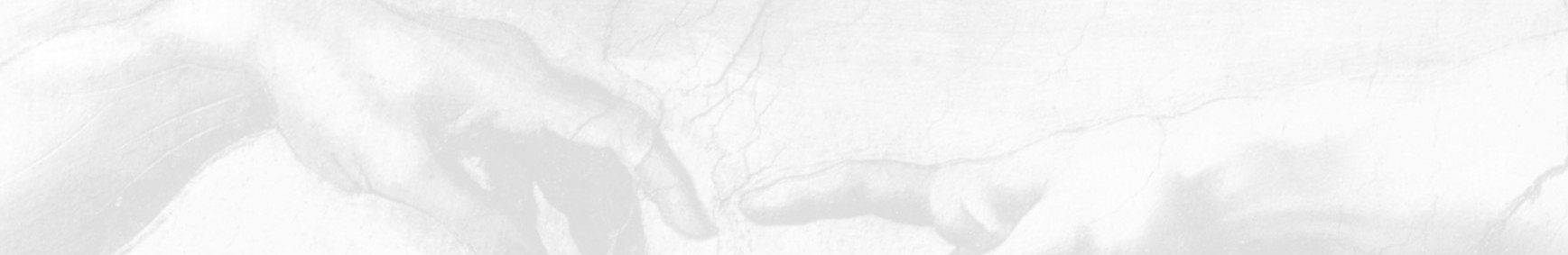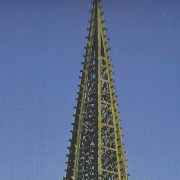Personalentwicklung in der Wissensgesellschaft – Herausforderungen für Unternehmen und Organisationen
„Wichtigste Ressource eines Unternehmens sind seine Mitarbeiter!“. Spätestens in der anbrechenden Wissensgesellschaft wird der Satz zum Allgemeingut. Manche Unternehmen wissen das schon lange und beherzigen es auch. Sie investieren in eine langfristig angelegte, systematische Personalentwicklung. Andere setzen primär auf Kapital, Maschinen und nicht zuletzt Subventionen. Mitarbeiter sehen sie als Kostenfaktor und lassen sie das auch spüren. Facharbeitermangel bewirkt jetzt ein Umdenken.
Wir überschreiten die Schwelle von der Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft zur Wissensgesellschaft. Für die Personalentwicklung bedeutet dies: „Wissensarbeiter“ und „Wissensarbeiterinnen“ (Peter Drucker) sind gefragt. Was meint dabei der vage Begriff „Wissen“? Wissen ist nicht einfach Bildung im landläufigen Sinn oder Faktenwissen, als wären Mitarbeiter wandelnde Lexika. Wissen ist ein komplexer und dynamischer Mix
- von erlernter Theorie und praktischer Erfahrung,
- von schnellem Recherchieren von Fakten und der Fähigkeit, diese zu deuten,
- von Planungs- und Umsetzungskompetenz,
- von hochspezialisiertem Fachwissen und allgemeinen sozialen Kompetenzen,
- von analytischer und emotionaler Intelligenz,
- von weiterführenden Fragen und möglichen Antworten,
- von Fixieren bewährter Standards und Experimentieren mit neuen Wegen…
Wissensarbeiter sind nicht allwissend, sondern wissbegierig.
Lernende Mitarbeiter in lernenden Unternehmen
Wie immer man Wissen definiert und ein Profil des Wissensarbeiters skizziert, Lernen ist die Voraussetzung dafür. Lebenslanges Lernen, um es genauer zu sagen. Dieses Wort ist allerdings nicht nur positiv besetzt. Den meisten kommen Erinnerungen an die eigene Schulzeit hoch: Pauken, Prüfungen, Pressionen. Merkwürdig: Kleine Kinder tun offensichtlich nichts lieber als Neues lernen – bei Jugendlichen lässt dies dramatisch nach und für viele Erwachsene wird Lernen zur Last. Es ist zu einfach, das Schulsystem oder die Lehrer für diese Entwicklung verantwortlich zu machen. Schule hat nur begrenzte Möglichkeiten, Lernen zu fördern. Pflicht und Disziplin werden immer damit verbunden verbleiben. Lernen in und für die Wissensgesellschaft ist Gott sei Dank mehr als schulisches Lernen. Wissensarbeiter brauchen noch andere Lernorte: Jugendarbeit, Sport, Vereine – Erfahrungslernen, Üben, Experimentieren – Dialog mit anderen, Kultur und Kunst – Unternehmen als Orte für praxisorientiertes Lernen, Team-Lernen – Selbstlernen durch Lesen oder Internet-Recherche. Diese Stichworte machen deutlich: Lernen ist wichtiger als Lehren.
Für Erwachsene stellen sich heute entscheidende Fragen: Sind sie (noch) bereit zu lernen? Können sie Lernen (auch) als Abenteuer und Herausforderung begreifen? Das ganze Gejammer: Hätten mich doch die Lehrer mehr gefördert und gefordert ist eine große Ausrede. Selbstverantwortung ist gefragt! Biologisch gesehen sind wir lernfähig bis ins hohe Alter. Was Hänschen nicht lernt, muss eben Hans lernen.
Die klassische Normalbiografie im Blick auf das Arbeitsleben hat in der Wissensgesellschaft keinen Bestand mehr: Schule – Ausbildung/Studium – Berufseinstieg – Arbeit – Karriere – Rente. Berufliche Praxis wird früher beginnen (Ferienjob/Praktika). Nach der letzten Prüfung wird die erste Fortbildung starten. Arbeit als Angestellter, Projektarbeit, Honorartätigkeit, Selbständigkeit, auch Zeiten der Arbeitslosigkeit wechseln sich ab. Vor allem aber: Berufstätigkeit wird Arbeiten plus Lernen sein. Diese Formel kennzeichnet die Wissensgesellschaft.
Wenn nicht alles täuscht, dann wird es zukünftig gleichzeitig Arbeitslosigkeit und Facharbeitermangel geben. Anders ausgedrückt: Menschen suchen verzweifelt Arbeit – Unternehmen verzweifelt Arbeiter. Was paradox klingt, erklärt der Begriff Wissensarbeiter. Diese sind gefragt, gesucht und gut bezahlt. Wer nicht dazu gehört, muss damit rechnen, dass sein Arbeitsplatz schlecht bezahlt oder plötzlich entbehrlich wird. Wissensarbeiter sind nicht durch Maschinen ersetzbar.
Unternehmen als Bildungseinrichtungen
Den Trend zur Wissensgesellschaft kann man aus zwei Perspektiven betrachten: Einmal aus der Sicht von Mitarbeitenden, die ihre Zukunft planen – zum anderen aus der Sicht von Unternehmen, die im Wettbewerb bestehen müssen. Gute Personalentwicklung verbindet beide Perspektiven. Mitarbeiterinnen werden zu Lernenden – Unternehmen werden lernende Organisationen; Mitarbeiter streben nach Wissen – Unternehmen gestalten Wissensmanagement; Mitarbeiterinnen besuchen Fortbildungen aller Art – Unternehmen entwickeln sich zu Bildungseinrichtungen.
Weltweiter Wettbewerb, Rationalisierungsmaßnahmen zur Effizienzsteigerung, Einzug neuer Technologien, Digitalisierung, Flexibilisierung und Deregulierung von Rahmenbedingungen, das sind Megatrends, die alle Bereiche der Gesellschaft durchdringen. Es mag bei diesen Umbrüchen gerade in Deutschland durch Wohlstand und Tradition noch viele Bremsen geben, aufhalten lassen sie sich nicht. Ob die Folgen gut oder schlecht sind, ist eine andere Frage. Da niemand Zukunft genau vorhersehen kann, sollte man vorsichtig sein mit Euphorie wie mit Verteufelung.
Wenn diese Trends zutreffen, welche Eckpunkte muss dann eine moderne Personalentwicklung in Unternehmen kennzeichnen? Sechs scheinen wesentlich.
1. Sich an Zielen und an Kunden orientieren
Stellenprofile beschreiben künftig Ziele im Blick auf Zielgruppen und nicht Tätigkeiten. Den Fokus auf Ziele statt auf Aufgaben zu setzen, klingt lediglich wie sprachliche Haarspalterei. Dahinter steckt aber eine entscheidende Weichenstellung. Zielorientiertes Arbeiten stärkt die Verantwortung der Angestellten. Mitarbeiter planen gestalten, reflektieren und verantworten selbständig ihre Arbeit im Rahmen von vereinbarten Zielen. Welches die geeigneten Wege zum Ziel sind, bestimmen sie selbst – müssen allerdings für Fehler und Scheitern auch Verantwortung übernehmen. Für die Führungskräfte und die Organisation bedeutet es lapidar, dass überhaupt Ziele entwickelt werden. Die meisten Chefs behaupten natürlich, dass sie Ziele haben; fragt man ihre Mitarbeiter, hört sich das ganz anders an: Mein Chef sagt immer: „Jetzt machen Sie mal…“ Zielorientiertes Arbeiten funktioniert nur, wenn Ziele gemeinsam entwickelt werden. Das heißt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden nach ihren Erfahrungen und ihrem Expertenwissen gefragt. Manche Vorgesetzten müssen erst lernen, solche Fragen zu stellen – manche Mitarbeiter, darauf Antworten zu geben.
2. Fordern und Fördern
Es geht um mehr als um ein schönes Wortspiel. Eine Balance ist gefragt: die gleichmäßige Entfaltung beider Pole. Die Herausforderungen, denen sich eine Organisation stellen muss, müssen klar sein – nicht nur abstrakt für die ganze Organisation, sondern für jeden Bereich, jeden Mitarbeiter. Dies werden durchaus Zumutungen sein. Es geht dabei um Qualität und Quantität, um Fachlichkeit und um Service, um den Einsatz knapper Ressourcen: Zeit, Geld, Mittel… Wenn diese Herausforderungen beschrieben sind, dann gilt es, die Mitarbeitenden zu fördern, damit sie ihnen mehr und mehr gewachsen sind. Dazu gehört, dass sich Vorgesetzte als Coach verstehen und nicht als Oberexperten, dass alle Formen interner und externer Fortbildung gezielt eingesetzt werden, so wie das einzelne Mitarbeitende brauchen. Nicht hier ein Kurs und dort eine Tagung aus irgendeinem dickleibigen Weiterbildungskatalog, sondern Auseinandersetzung mit dem einzelnen Mitarbeiter, mit seinen Herausforderungen, mit seinen Stärken und Schwächen. Ein Entwicklungsprogramm vereinbaren, individuell und spezifisch.
3. Beteiligen und Ermächtigen
Dies klingt basisdemokratisch. Was dahinter steht, wurde aber nicht in demokratischen Diskursen entwickelt, sondern im Wettbewerb. Ein Monopolist oder ein subventioniertes Unternehmen kann es sich leisten, dass nur ein paar an der Spitze denken und lenken – ein Unternehmen im Wettbewerb nicht. Sie können es auch poetischer ausdrücken: Es gilt das Gold in den Köpfen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu heben, das sich angesammelt hat aus langer Erfahrung, vielen Experimenten, Fehlern, Kundenkontakten und persönlichen Neigungen. Partizipation und Empowerment sind, wenn Sie so wollen, demokratische Werte – um so besser. Hier geht es darum, dass es überlebensnotwendige Punkte sind im Wettbewerb.
4. Steuern und Lernen
Die meisten Tätigkeiten in einem Unternehmen sind klar. Jeder und jede weiß, was zu tun ist. Stellenbeschreibungen, interne Leitlinien oder Qualitätshandbücher schreiben Arbeitsabläufe vor. Diese Klarheit und die traditionelle Regulierung hierzulande haben ihre guten Seiten aber auch eine fatale Folge. „Das-machen-wir-schon-immer-so“ wird zur Leitmelodie. Für die Mitarbeiter ist das bequem, allerdings wenig reizvoll. Vor allem: Innovation findet nicht statt. Um Verbesserungen für die Kunden zu erreichen, braucht es eine andere Leitmelodie: „Das-probieren-wir-jetzt-einmal-anders“. Dazu braucht es Mitarbeiterinnen mit entsprechenden Haltungen: Mut, Experimentierfreude, Neugier, zu Fehlern stehen… Und es braucht Unternehmen mit entsprechender Lernkultur. Weil Mitarbeiter lernfähig sind, kann ein System lernfähig werden; wenn ein System das Lernen proklamiert, werden Mitarbeiterinnen lernwilliger.
5. Bewerten und Honorieren
Viele meinen immer noch, es sei gut und menschlich, wenn Leistungsbeurteilung nicht im Vordergrund steht. Wahre Motivation, heißt es dann, kommt nicht über Leistungsprämien, sondern über die Lust an der Arbeit. Wohl wahr. Leistung bewerten und honorieren sollte auch nicht um der Motivation willen geschehen, sondern um der Gerechtigkeit willen. Gerecht ist es aber nicht, wenn ein Mitarbeiter kreativ und initiativ seine Ziele verfolgt, während andere um ihn herum dies nicht tun und trotzdem genauso viel verdienen oder sogar mehr. Eine Zeitlang wird dies aufgefangen durch jugendliche Begeisterung, Idealismus oder ethische Überzeugungen. Dann kommt der Frust, schließlich die innere Kündigung. Leistungsbewertung ist vor allem eine Möglichkeit, den Mitarbeitenden Feedback zu geben. Genau davor kneifen viele Chefs, was in Mitarbeiterbefragungen immer wieder deutlich wird. Leistungsbeurteilung als Feedback verlangt regelmäßige Mitarbeitergespräche, in denen Vorgesetzte den Mitarbeitern ihre durchaus subjektive Bewertung offen sagen und verzichtet auf pseudoobjektive Leistungsmessung (z. B. Stückzahl oder ähnliches).
6. Informieren und Kommunizieren
Aus dem bisherigen ergibt sich folgerichtig, dass Mitarbeiter Zugang zu allen Informationen brauchen, dass das Weitergeben von Informationen und Wissen gesteuert werden muss und dass regelmäßiges und strukturiertes dialogisches Kommunizieren zu einer lernenden Organisation gehören.
Personalentwicklung als unternehmerische Aufgabe
Die sechs Eckpunkte machen deutlich, dass Personalentwicklung in der Wissensgesellschaft mehr sein muss als die fünf Tage Fortbildungsurlaub für jeden Mitarbeiter pro Jahr, mehr auch als einige Inhouse-Seminare oder das Angebot von Coaching. Es geht um Systematik und Strategie, um Innovation und Nachhaltigkeit. Ein Unternehmen muss wissen, welche Ziele es langfristig erreichen will und dementsprechend die Entwicklung der Mitarbeitenden zur unternehmerischen Aufgabe machen. Entwicklung heißt nicht, dass die Mitarbeiter Objekte sind, gleichsam entwickelt werden müssen. Sie sind Subjekte, die einen Raum brauchen, um sich selbst zu entwickeln. Das bedeutet, ein Personalentwicklungskonzept wird immer mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erarbeitet.
Personalentwicklung ist kein Patentrezept für unternehmerischen Erfolg. Ergebnisse wird es nur langfristig liefern. In der Wissensgesellschaft, in der menschliche Ressourcen entscheidender sind als Maschinen, ist Personalentwicklung schlicht not-wendig, um Unternehmensziele zu erreichen und Kunden zufrieden zu stellen.
Meinrad Bumiller