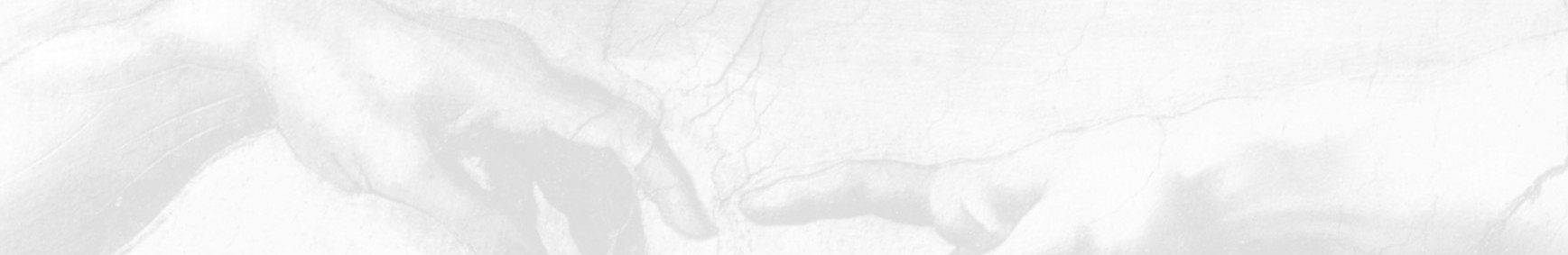Der Regierungspräsident bittet seinen Abteilungsleiter Straßenbau zu sich: „Sie wissen es geht um unser heikles Straßenbauprojekt im Süden…“ Natürlich weiß der erfahrene Straßenplaner Bescheid. Die besagte Bundesstraße, von Journalisten als „Straße der Leiden“ tituliert, hat ein hohes Verkehrsaufkommen, führt durch eine schöne, bei Touristen beliebte Landschaft. Links und rechts gibt es intensive landwirtschaftliche Nutzung durch Obst- und Weinbau. Dörfer, Höfe, Weiler liegen eng beieinander, dazwischen auch noch einige Naturreservate. Was dringend ansteht, ist die Umfahrung für einige Dörfer und Kleinstädte, durch die sich der Verkehr im Moment mitten hindurch wälzt.
„Wir können die Trasse planen wie wir wollen. Entweder verscherzen wir es mit den Anwohnern und Grundstückseigentümern, oder wir haben die Naturschützer gegen uns oder die Landwirte oder die Hotelbetreiber oder alle zusammen“, meint der Straßenplaner mit resigniertem Tonfall.
„Aber der jetzige Zustand ist untragbar. Jedes Mal, wenn ich dort unterwegs bin, stehe ich im Stau und lese die Schilder am Straßenrand: „Politiker und Planer vielen Dank für Lärm und Gestank“, entgegnet der Regierungspräsident etwas ungehalten.
„Selbst wenn wir gut planen und das Verfahren beschleunigen, kann es noch ein Jahrzehnt gehen mit permanenten Gerichtsterminen“, warnt der bedächtige Abteilungsleiter.
„Dann müssen wir es eben anders machen als bisher. Sie müssen ein Verfahren entwickeln, das Betroffene zusammenbringt, konstruktiven Dialog ermöglicht, einen Wettbewerb an Ideen schafft und ein gemeinsames Ziehen an einem Strang bewirkt. Sie müssen das moderieren.“
„Herr Präsident ich habe Straßenbau studiert…“.
„Und ich Rechtswissenschaft“, erwidert der Präsident unbeeindruckt, „und jetzt werden wir beide umlernen“.
Vom hoheitlichen Eingreifen zum gemeinsamen Lernen
Dieser Dialog ist frei erfunden. Doch er spiegelt die Herausforderung und die Not vieler Planer im öffentlichen Bereich wider. Dabei geht es nicht nur um den klassischen Gegensatz zwischen Landschaftsgestaltung und Landschaftserhaltung. Letztere wird ja auch geplant und mündet möglicherweise in Großprojekte wie die Ausweisung neuer Naturschutzgebiete. Jede Veränderung gegenwärtiger Verhältnisse, insbesondere der Besitzverhältnisse, bringt Widerstände und Konflikte, schließlich langwierige Gerichtsverfahren. Dabei sind die Voraussetzungen doch optimal: Erfahrene Experten aus allen Bereichen, ausgebildet an den besten Hochschulen, erarbeiten solide Planungen in den Behörden. Detaillierte rechtsstaatliche Verfahren regeln das Vorgehen und die zeitlichen Fristen, garantieren Anhörungs- und Einspruchsrechte. Alles läuft hierzulande geordnet, geplant, gerecht. Und trotzdem dauert das ganze Jahre-, wenn nicht gar jahrzehntelang. Der Widerstand ist immens, die Unzufriedenheit groß. Sie bleibt auch bestehen, wenn die letzte Berufungsinstanz ihr Urteil gesprochen hat. Legalität bewirkt nicht automatisch Akzeptanz! Dabei sind konfliktive Großprojekte nur die Spitze des Eisbergs. Die langfristige und gezielte Entwicklung von Kommunen und Regionen insgesamt verlangt nach neuen Steuerungsmöglichkeiten. Nachhaltigkeit im Sinne der Lokalen Agenda 21 kann man nicht verordnen. Eine Region wird nicht durch Subventionen und Infrastruktur zum Wirtschaftsstandort, sondern als „lernende Region“. Zusammenfassend: Es gibt unzählige Vorhaben, die mit klassischen Mitteln – Anordnung und Zwang, legitimiert durch Gesetze – nicht mehr gelöst werden können.
Warum es die öffentliche Verwaltung immer schwerer hat
Wer die ganze Misere nur einigen Querulanten, notorischen Nörglern oder fundamentalistischen Umweltschützern in die Schuhe schieben will, der muss sich nur mal dort umhören, wo ganz normale Bürger und Gruppen diskutieren. Jene, die „bis zur letzten Instanz“ vor Gericht gehen, um ihre Interessen durchzusetzen, kommen aus allen gesellschaftlichen Gruppierungen und politischen Lagern. Die Problematik liegt tiefer. Mindestens vier gewichtige Phänomene sorgen derzeit für die Steuerungsprobleme bei öffentlichen Projekten. Alle vier überlagern und verstärken sich wechselseitig.
Komplexität
Die Einflussgrößen bei öffentlichen Projekten sind auf vielfältige Weise miteinander vernetzt und verbunden. Dreht man an einer Schraube, verändern sich viele andere. Jeder Eingriff hat vielfältige Folgen. Berechenbar sind meistens nur die kurzfristigen, ganz zu schweigen von den Folgen der Folgen und den berüchtigten Nebenwirkungen. Alle Vorhaben entwickeln eine eigene Dynamik und diese läuft heute meist mit hoher Beschleunigung ab. Jedes Handlungsmodell, wenn es noch so beeindruckende wissenschaftliche Begriffe verwendet, erfasst nur einen Teil der Wirklichkeit. Man kann den Lebensraum nicht zergliedern in Verkehrsräume, Gewerbezonen, Erholungsgebiete etc. Es gibt nur eine Landschaft.
Wer komplexe Probleme lösen will, braucht auf jeden Fall interdisziplinäre Kompetenzen und dies verlangt intensive Kommunikation und Kooperation zwischen unterschiedlichen Akteuren, Wissenschaften, Institutionen.
Interessenvielfalt
Der Landwirt hat andere Interessen als der Hotelier nebenan, dieser wiederum andere als der Naturliebhaber und jener andere als der Unternehmer. Alle leben möglicherweise im gleichen Dorf und beabsichtigen nicht wegzuziehen. Die Interessenvielfalt nimmt zu, weil eine offene Gesellschaft einzelnen die Freiheit gibt, sich in vielfältige Richtungen zu entwickeln. Verschiedene Interessen brauchen einen fairen Ausgleich. Oft eskalieren verschiedene Interessenlagen zu heftigen Konflikten, in denen die Forderungen der jeweils anderen zum „bloßen Egoismus“ abgestempelt und die eigenen flugs zum „Gemeinwohl“ hochstilisiert werden. Es geht dann plötzlich um „die Wahrheit“ und da es keinen Wahrheitsausgleich geben kann, beginnen die „Kreuzzüge“. Wer für die Wahrheit kämpft, statt für seine Interessen, wird rücksichtsloser. Fundamentalismus hat fatale Folgen – aber es gibt ihn nicht nur im Orient, auch hierzulande. Gefragt ist Dialogbereitschaft, allerdings nicht mit den Gleichgesinnten – sondern mit den Andersdenkenden, nicht innerhalb der eigenen Interessengemeinschaft – sondern mit den Anderen am „Runden Tisch“.
Individualisierung
Menschen bestimmen ihr Leben selbst, nach eigenen sehr individuell geprägten Wertmaßstäben. Die Orientierung an traditionellen, gemeinsam getragenen Wertesystemen nimmt ab. Manche setzen Individualismus mit Egoismus gleich. Dies greift zu kurz. Sehr wohl sind auch höchst individualistisch veranlagte Personen zu sozialem Handeln, zur Großzügigkeit und zum Einsatz für andere in der Lage. Aber sie tun dies eben selbst-bestimmt, selbst-gesteuert, frei-willig. Dies bedeutet mindestens, dass traditionelle Autoritäten nicht einfach länger Vorgaben machen können, die dann breite Akzeptanz erreichen. Akzeptanz ist heute freie Zustimmung jedes einzelnen. Sie entsteht, wenn überhaupt, in einem mühseligen und langwierigen Prozess, in einem offenen Dialog, durch Verhandeln und Überzeugen, durch Annäherung und Ausgleich. Alle Beteiligten müssen dabei ein Minimum an Empathie, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung entwickeln.
Beteiligung
Viele Bürger sind nicht länger willens alle paar Jahre mit einem Kreuz bei einer Wahl die Gestaltung ihrer Umwelt an professionelle Politiker und Planer zu delegieren. Sie möchten beteiligt werden – mindestens dort, wo ihre elementaren Interessen und ihr direkter Lebensraum berührt sind. Manche sehen den Ruf nach Partizipation als verspätetes Denken aus der 68er Zeit und meinen im Moment sei Apathie und Politikverdrossenheit das Gefühl der Mehrheit. Man kann dies aber auch anders sehen – nämlich: die verbreitete Politikmüdigkeit als ein Symptom für die lange Erfahrung, nicht gefragt, nicht gehört und nicht beteiligt zu werden. „Die da oben machen ja doch was sie wollen; dann machen wir da unten eben auch, was wir wollen.“ Dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht direkt politisch aktiv ist, erklärt sich bereits aus der beruflichen und familiären Belastung der meisten Menschen. Es ist ein arroganter Trugschluss, daraus politisches Desinteresse zu folgern. Demokratien brauchen Orte und Räume, wo „Herrschaft des Volkes“ konkret und kreativ wird. Ohne praktizierte Partizipation vor Ort wird es auf Dauer auch keine repräsentative Demokratie auf nationaler oder europäischer Ebene geben.
Es mag noch andere, durchaus auch widersprüchliche Trends geben. Offenkundig ist jedenfalls, dass angesichts dieser Dynamik staatliches Handeln ein breiteres und differenzierteres Repertoire braucht – nicht nur Gesetze und Gesetzesvollzug. Mit einem Begriff von Anthony Giddens: Es geht darum, eine „dialogische Demokratie“ zu entwickeln. Welche Kompetenzen sind dafür notwendig?
Zwei Schlüsselkompetenzen: Moderieren und Prozesse managen – 7 Eckpunkte
Im Blick auf alltägliche Praxis schieben sich für Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung wie für politische Mandatsträger wenigstens zwei Schlüsselkompetenzen in den Vordergrund: Moderations-Fähigkeit und Prozessmanagement-Kompetenz.
Moderare im Lateinischen meint ursprünglich mäßigen, ein Maß setzen. Aus dem englischen moderate kam vor allem durch das Fernsehen der Moderator in unseren Sprachgebrauch. In der Erwachsenenbildung wurde die Moderationsmethode entwickelt, um in Organisationen Workshops zu gestalten. Moderieren im öffentlichen Kontext ist mehr als eine Methode und keine Talkshow. Es heißt, Menschen „Räume“ verschaffen und darin eine Struktur, damit diese selbst vielfältige Ideen und Interessen, Visionen und Optionen, Pläne und Projekte entwickeln können. Moderatoren sind Architekten des Dialogs – oder mit einem anderen Bild, das schon Sokrates verwendete: Hebammen.
Moderieren ist eine Kunst, die am ehesten bipolar beschrieben werden kann: Raum geben und begrenzen, strukturieren und Strukturen in Frage stellen, mäßigen und animieren, respektieren und konfrontieren, beschleunigen und verlangsamen, konkretisieren und auf das Ganze blicken, Komplexität erweitern und reduzieren, auf das Ziel und auf den Weg schauen. Moderieren ist eben nicht mäßigen im Sinne von ruhigstellen, sondern es heißt, das rechte Maß finden, die Mitte. Im Bild der Reise gesprochen: Ein Moderator ist nicht der Pfadfinder, der den Weg kennt, sondern der, der eine wild zusammengewürfelte Gruppe zu Pfadfindern macht.
Während Moderieren auf das Steuern und Gestalten der Zusammenkünfte von Menschen abhebt, zielt Prozessmanagement eher auf all die Tätigkeiten, die vor, nach und zwischen solchen Treffen liegen: Planen, organisieren, einander informieren, vernetzen, koordinieren, Ressourcen beschaffen, kontrollieren… Prozesse managen heißt, Beschlossenes im Zusammenspiel vieler und verschiedener Akteure umsetzen. Den Prozess (lat.: procedere = fortschreiten, sich entwickeln) der Umsetzung Schritt für Schritt, effektiv und effizient zu gestalten, ist die Sache des Prozessmanagers.
Der Moderator steuert Dialoge, der Prozessmanager die dort vereinbarten Maßnahmen; Moderieren betont eher die kommunikative Seite, Prozesse managen eher die organisatorische. Beides sind die zwei Seiten einer Medaille. In der Praxis lebt die Kunst des Moderierens und des Prozessmanagements von ca. sieben Eckpunkten.
1. Räume der Beteiligung schaffen
Es braucht Initiative, dass Menschen an einem Ort zu einer bestimmten Zeit zusammenkommen, um ein Thema zu diskutieren. „Der eigentliche Sinn des Politischen ist mit dem Anfangen können aufs engste verbunden“ (Hannah Arendt). Raum bedeutet auch Struktur: Ein Thema in einer bestimmten Reihenfolge angehen. Weil Emotionen im Spiel sind, braucht es Regeln, an die sich alle halten. Für einzelne Schritte eine angemessene Zeit anzuberaumen, ist die Leistung der Moderatoren. Raum schaffen kann heute auch virtuell mit Hilfe der neuen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten erfolgen. Raum schaffen heißt: zur Selbststeuerung anregen statt appellieren oder anordnen.
2. Präsentieren und Sensibilisieren
Verständliches Reden einerseits – aktives Zuhören andererseits: Intensivierung von Rückkoppelungen durch Wiederholen, Zusammenfassen, Nachfragen, Konkretisieren, Präzisieren… Moderatoren können wie Kanalarbeiter wirken: Verstopfungen, Verkalkungen, Vereisungen beseitigen… Es braucht das Aktivieren der emotionalen Intelligenz: eigene Gefühle und die der anderen wahrnehmen und ins Wort bringen ohne Gefühlsausbrüche. Hilfreich sind Fragen: offene, respektvolle, wertschätzende, konkretisierende Fragen.
3. Dialogisch kommunizieren
Dialog lebt wesentlich von fünf Dimensionen: Unterschiedliche Perspektiven würdigen, Mentale Modelle aufbrechen, weil Denkgewohnheiten und traditionelle Handlungsmuster Innovationen blockieren; Vielfältige Optionen entwickeln – denn nichts ist alternativlos, Gemeinsame Werte, Visionen, Ziele suchen, Dissens präzisieren und im konstruktiven Streit aufheben.
„Einsicht in einen politischen Sachverhalt heißt nichts anderes, als die größtmögliche Übersicht über die möglichen Standorte und Standpunkte, aus denen der Sachverhalt gesehen und von denen er beurteilt werden kann, zu gewinnen und präsent zu haben“ (Hannah Arendt).
4. Verhandeln, Vermitteln, Vereinbaren
Wenn man als allgemeines Ziel eine „win-win-situation“ anstrebt, dann darf dies nicht nur eine moralische Beschwörung sein, sondern muss in konkretes Verhandeln führen. In der Verwaltungspraxis bieten sich mediative Problemlösungen also vor allem dort an, wo die exekutiven Spielräume groß sind, etwa im Vorfeld von Planfeststelllungen.
5. Effektiv und effizient projektieren
Grundsätzlich werden beschlossene Maßnahmen zu einem Projekt oder zu mehreren. Dies verlangt gekonntes Projektmanagement. Kein noch so gekonntes Planen wird jeden Widerstand verhindern. Deshalb braucht es möglicherweise, das was Organisationsentwickler etwas geschwollen Feedbackschleifen nennen: Neu diskutieren, verbessern, neu vereinbaren… Wer Widerstand nicht ernst nimmt und thematisiert, drängt ihn in den Untergrund und muss sich dann über „terroristische“ Querschüsse nicht wundern.
6. Transparenz herstellen
Auch wenn die Beteiligung bei dialogischen Prozessen groß ist – alle Betroffenen sind niemals dabei. Also müssen getroffene Entscheidungen kommuniziert werden. Dies ist schwierig, weil jetzt viele ins Boot geholt werden müssen, die bei der „Reiseplanung“ gar nicht dabei waren. Dinge durchschaubar zu machen, ist für eine Demokratie keine Zugabe sondern elementarer Bestandteil. Es geht um aktive Öffentlichkeits-Arbeit. Professionelles Projekt- und Netzwerkmanagement setzt ein abgesprochenes internes Informationsmanagement voraus. Dies kann mit modernen elektronischen Mittel bewerkstelligt werden.
7. Reflektierend Lernen
Wenn es zutrifft, dass Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung immer häufiger als Moderatoren und Prozessmanager handeln müssen, dann lohnt es sich gewonnene Erfahrungen zu reflektieren und festzuhalten: Lernende Verwaltung.
Aktives Vertrauensmanagement
Vertrauen ist die Basis für alle genannten Eckpunkte. Nur in einer Vertrauenskultur können Moderatoren und Manager ihre Kompetenzen entfalten. Vertrauen verhindert, dass Fehler (davon gibt es immer genug) Konflikte eskalieren lassen; es macht sie als Lernchancen nutzbar. Prägt Misstrauen die Kultur, dauert alles länger, wird konfliktreicher, stressiger und bürokratischer. Wo sonst ein Wort gilt, braucht man dicke Verträge und viele Anwälte. Die Transaktionskosten steigen ins unermessliche.
Vertrauen kann man aufbauen – allerdings kaum durch Instrumente, wohl aber durch entsprechende Haltungen. Zunächst einmal geht es darum, den Menschen, die jetzt gerade da sind, zu zutrauen, dass sie die anstehende Aufgabe meistern werden.
Reinhard Sprenger hat es auf den Punkt gebracht: „Der Schlüssel zu einer Vertrauenskultur ist mithin die – nicht nur behauptete, sondern tief innerlich empfundene – Einstellung, dass es auf jeden einzelnen Menschen ankommt, dass seine persönlichen Bedürfnisse und Interessen zählen, dass er ein selbstbestimmtes Individuum ist. Keine Managementmethode wird jemals funktionieren, wenn es ihr an authentischem Respekt vor dem einzelnen Menschen fehlt.“
Zusammenfassend: Eine neue Kultur wagen…
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung praktizieren längst schon diese Ideen. Von Kollegen und von vorgeordneten Behörden werden sie oftmals kritisch beäugt: „Management mag in der Industrie funktionieren, nicht in der Verwaltung. Moderieren kann man Talkshows, nicht Eingriffe und hoheitliche Handlungen. Das ist alles viel zu weich!“ In der Tat moderieren und managen gehört zu den „soft factors“. Diese sind per definitionem schwerer zu handhaben, weil nicht messbar, nicht aufteilbar in „richtig“ und „falsch“, nicht einklagbar, nicht einmal immer sichtbar. Für handfeste Verwalter ein Graus. Dagegen ist nur zu sagen, dass so ziemlich alles, was wichtig ist im Menschsein, in Gemeinschaften, auch in der liberalen Demokratie aus „soft factors“ – anders ausgedrückt – aus Kultur besteht. Die gelebte Kultur von staatlichem Handeln muss sich ändern, nicht nur das Vokabular und nicht nur das Repertoire an „Werkzeugen“. Instrumente der Moderation und des Managements ohne dialogische Haltung werden zynisch.
Mit Worten der Kommission der EU: „Das alte lineare Modell, bei dem die Politik von oben herab verkündet wird, muss durch einen circulus virtuosus ersetzt werden, einen Spiralprozess, der – von der Gestaltung bis zur Durchführung der Politik – auf Rückkoppelung, Netzwerken und Partizipation auf allen Ebenen beruht.“
Bei allem Plädoyer für kompetentes Moderieren und Managen staatlicher Akteure, dies darf nicht die Herrschaft des Rechts beeinträchtigen. Die staatliche Steuerungskompetenz gilt es zu erweitern, weil dies die faktischen Probleme erfordern. Die Bürger müssen stärker ins Spiel gebracht werden. Bleiben müssen die Entscheidungskompetenz der gewählten Gremien, Rechtsschutz und gerichtliche Überprüfbarkeit. Der „moderierende“ Staat ersetzt nicht sein Steuerungsrepertoire, er ergänzt es.